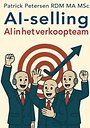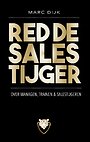Erster Teil Die Rolle der Information im Marketing.- 1. Informationen als Grundlage unternehmerischer Entscheidungen.- 1.1. Der Begriff „Information“.- 1.2. Die Bedeutung von Informationen in den Entscheidungsprozeß-phasen.- 1.2.1. Planung.- 1.2.2. Organisation.- 1.2.3. Kontrolle.- 1.2.4. Zusammenfassung.- 1.3. Die Bewertung von Informationen.- 1.3.1. Bewertungskriterien.- 1.3.2. Der Bayes-Ansatz.- 2. Information und Marketingpolitik.- 2.1. Begriffliche Abgrenzungen.- 2.2. Der Marktforschungsprozeß.- 3. Organe der Informationsbeschaffung.- 3.1. Betriebliche Marktforschung.- 3.2. Institutsmarktforschung.- 3.3. Marktforschungsberater und Informationsbroker.- 3.4. Berufsorganisationen.- 4. Informationsquellen.- 4.1. Sekundärforschung.- 4.2. Primärforschung.- Zweiter Teil Methoden der Marktforschung.- 1. Datenerhebung.- 1.1. Auswahlverfahren.- 1.1.1. Verfahren der Zufallsauswahl (Random-Verfahren).- 1.1.1.1. Einfache, reine Zufallsauswahl.- 1.1.1.2. Geschichtete Zufallsauswahl (stratified sampling).- 1.1.1.3. Klumpenauswahl (cluster sampling).- 1.1.1.4. Mehrstufige Verfahren.- 1.1.2. Verfahren der bewußten Auswahl.- 1.1.2.1. Quota-Verfahren.- 1.1.2.2. Auswahl nach dem Konzentrationsprinzip (Cut-off-Verfahren).- 1.1.2.3. Typische Auswahl.- 1.2. Fehler und Genauigkeit.- 1.2.1. Zufallsfehler.- 1.2.2. Systematische Fehler.- 1.3. Meßtheoretische Grundlagen.- 1.3.1. Messen und Meßdaten.- 1.3.2. Meßniveaus.- 1.4. Skalierung.- 1.4.1. Selbsteinstufungsverfahren.- 1.4.2. Fremdeinstufungsverfahren.- 1.4.2.1. Verfahren der Indexbildung.- 1.4.2.2. Eindimensionale Skalierung i. e. S.- 1.4.2.3. Mehrdimensionale Skalierung.- 1.4.2.3.1. Das Semantische Differential.- 1.4.2.3.2. Multiattributmodelle.- 1.5. Götekriterien.- 1.5.1. Objektivität.- 1.5.2. Rehabilität.- 1.5.3. Validität.- 1.5.3.1. Interne Validität.- 1.5.3.2. Externe Validität.- 1.6. Erhebungsmethoden in der Ad-hoc-Forschung.- 1.6.1. Befragung.- 1.6.1.1. Exploration.- 1.6.1.2. Gruppendiskussion.- 1.6.1.3. Standardisiertes möndliches Interview.- 1.6.1.4. Schriftliche Befragung.- 1.6.1.5. Telefonbefragung.- 1.6.1.6. Computergestötzte Datenerhebung.- 1.6.2. Beobachtung.- 1.6.2.1. Elemente der Beobachtung.- 1.6.2.2. Beobachtungsverfahren.- 1.7. Panelforschung.- 1.7.1. Verbraucherpanel.- 1.7.2. Handelspanel.- 1.8. Experiment.- 1.8.1. Grundlagen.- 1.8.1.1. Projektive versus Ex-post-facto-Experimente.- 1.8.1.2. Laborexperimente versus Feldexperimente.- 1.8.1.3. Versuchsanordnungen.- 1.8.2. Anwendungen.- 1.8.2.1. Produkttest.- 1.8.2.2. Storetest.- 1.8.2.3. Markttest.- 1.8.2.4. Testmarktersatzverfahren.- 1.8.2.4.1. Minimarkttest.- 1.8.2.4.2. Testmarktsimulation.- 1.8.2.5. Werbewirkungsforschung.- 1.8.2.5.1. Werbeträgerforschung.- 1.8.2.5.2. Spezielle Instrumente zur Messung von Werbewirkungen.- 2. Datenauswertung.- 2.1. Deskriptive Statistik.- 2.1.1. Univariate Verfahren.- 2.1.1.1. Eindimensionale Häufigkeitsverteilungen.- 2.1.1.2. Parameter von Häufigkeitsverteilungen.- 2.1.2. Bivariate Verfahren.- 2.1.2.1. Kreuztabellierung.- 2.1.2.2. Korrelationsanalyse.- 2.1.2.3. Einfache Regressionsanalyse.- 2.1.3. Multivariate Analyseverfahren.- 2.1.3.1. Klassifikation der Verfahren.- 2.1.3.2. Multiple Korrelationsanalyse.- 2.1.3.3. Multiple Regressionsanalyse.- 2.1.3.4. Varianzanalyse.- 2.1.3.5. Diskriminanzanalyse.- 2.1.3.6. Faktorenanalyse.- 2.1.3.7. Clusteranalyse.- 2.1.3.8. Multidimensional Skalierung.- 2.1.3.9. Weitere Verfahren.- 2.1.3.10. Der Anwendungsbereich multivariater Analyseverfahren.- 2.2. Induktive Statistik.- 2.2.1. Grundlagen.- 2.2.2. Einzelne Verfahren.- 2.2.2.1. Chi-Quadrat-Test.- 2.2.2.2. Weitere Tests.- 2.3. Zusammengefaßter Öberblick öber den arbeitstechnischen Ablauf der Datenauswertung.- 3. Datenauswertung bei ausgewählten Problemstellungen.- 3.1. Marktsegmentierung.- 3.1.1. Aufgabenstellung und Bedeutung.- 3.1.2. Segmentierungskriterien.- 3.1.3. Qualitative Marktsegmentierung mit dem Verbraucherpanel.- 3.2. Prognoseverfahren.- 3.2.1. Der Begriff „Prognose“.- 3.2.2. Arten von Prognosemodellen.- 3.2.3. Prognosemethoden.- 3.2.3.1. Quantitative Prognosemethoden.- 3.2.3.1.1. Exponentielles Glätten (exponential smoothing).- 3.2.3.1.2. Trendextrapolation.- 3.2.3.1.3. Multivariate Prognoseverfahren.- 3.2.3.2. Qualitative Prognosemethoden.- 3.2.3.2.1. Expertenbefragung.- 3.2.3.2.2. Delphi-Methode.- 3.2.3.2.3. Szenario-Technik.- Dritter Teil Besonderheiten der Marktforschung in ausgewählten Märkten.- 1. Marktforschung auf gewerblichen Märkten.- 1.1. Charakteristika der gewerblichen Nachfrage.- 1.2. Besonderheiten der Marktforschung.- 1.2.1. Transparentere Märkte.- 1.2.2. Die Bedeutung der Verhaltensforschung.- 1.2.3. Die Bedeutung quantitativer Marktforschung.- 1.2.4. Die Bedeutung der Handelsforschung.- 1.2.5. Die Bedeutung der derivativen Bedarfsforschung.- 1.2.6. Die Bedeutung der Konjunkturforschung.- 1.2.7. Besonderheiten der Erhebungsarbeit.- 2. Marktforschung im Einzelhandel.- 2.1. Die Rolle des Einzelhandels in der Distribution.- 2.2. Besonderheiten der Marktforschung.- 2.2.1. Der Stellenwert der Marktforschung im Einzelhandel.- 2.2.2. Die Bedeutung der Kundenforschung.- 2.2.3. Die Bedeutung der Imageforschung.- 2.2.4. Die Bedeutung der Konkurrenzforschung.- 2.2.5. Die Bedeutung der Standortforschung.- 2.2.6. Die Bedeutung der Panelforschung.- Vierter Teil Angewandte Marktforschung.- 1. Einföhrung.- 1.1. Ausgangslage.- 1.2. Vorgehensweise.- 2. Marktanalyse.- 2.1. Analyse des Gesamtmarktes „Alkoholfreie Erfrischungsgetränke“.- 2.1.1. Ziel der Gesamtmarktanalyse.- 2.1.2. Informationsbedarf und Informationsbeschaffung.- 2.1.3. Ergebnisse der Gesamtmarktanalyse.- 2.1.3.1. Einordnung des AfG-Marktes in den Getränkemarkt.- 2.1.3.2. Struktur des AfG-Marktes.- 2.1.3.3. Absatzkanäle im AfG-Markt.- 2.1.3.4. Entwicklung des Gesamtmarktes und der Teilmärkte.- 2.1.3.5. Relevante Teilmärkte.- 2.1.4. Präferierung des Fruchtsaftmarktes.- 2.2. Analyse des Fruchtsaftmarktes.- 2.2.1. Ziel der Fruchtsaftmarktanalyse.- 2.2.2. Informationsbedarf und Informationsbeschaffung.- 2.2.3. Ergebnisse der Auswertung sekundärstatistischen Materials.- 2.2.4. Ergebnisse der Haushaltspanelauswertung.- 2.2.4.1. Wettbewerber und Marken.- 2.2.4.2. Produkte.- 2.2.4.3. Einkaufsstätten.- 2.2.4.4. Konsumenten.- 3. Produktpositionierung.- 3.1. Ziel der Produktpositionierung.- 3.2. Informationsbedarf und Informationsbeschaffung.- 3.2.1. Verfahren zur Produktpositionierung.- 3.2.2. Vorgehen.- 3.3. Bedarfsanalyse: Ermittlung von Beurteilungsdimensionen und relevanten allgemeinen Einstellungen.- 3.3.1. Ziel der Bedarfsanalyse.- 3.3.2. Informationsbedarf und Informationsbeschaffung.- 3.3.3. Auswertung sekundärstatistischen Materials.- 3.3.3.1. Notwendigkeit der laufenden Trendbeobachtung.- 3.3.3.2. Einstellungs- und verbrauchsverhaltensbezogene Trends.- 3.3.4. Pilotstudie.- 3.3.4.1. Ziel der Pilotstudie.- 3.3.4.2. Durchföhrung der Gruppenexploration.- 3.3.4.3. Statementanalyse.- 3.3.4.4. Ergebnis: Ein Anforderungsspektrum und allgemeine Einstellungen.- 3.3.5. Paneleinfrage.- 3.3.5.1. Grundsätzliches zur Paneleinfrage.- 3.3.5.2. Durchföhrung und Auswertung.- 3.3.5.3. Ergebnis: Die Konsumentengruppen im Beurteilungsraum und relevante allgemeine Einstellungen.- 3.3.6. Ergebnis: Anspröche und Einstellungen der Nachfrager.- 3.4. Verbraucherbefragung.- 3.4.1. Ziel der Befragung.- 3.4.2. Informationsbedarf und Informationsbeschafföng.- 3.4.3. Durchföhrung der Befragung.- 3.4.4. Ergebnis: Das vollständige Marktbild.- 3.5. Zusammenfassende Interpretation: Positionierung.- 3.5.1. Bewertung der Positionierungslöcken.- 3.5.2. Ergebnis: Die Position.- 3.6. Zusammenfassung.- 4. Marktforschung und Produktentwicklung.- 4.1. Produktpolitik.- 4.1.1. Ideenphase.- 4.1.2. Konzeptphase.- 4.1.3. Konkretisierungs- und Testphase.- 4.1.3.1. Produktentwicklung.- 4.1.3.2. Qualitätstest.- 4.1.3.3. Namenstest.- 4.1.3.4. Flaschentest.- 4.1.4. Das Produkt.- 4.1.5. Zusammenfassung.- 4.2. Preispolitik.- 4.3. Distributionspolitik.- 4.4. Kommunikationspolitik.- 4.4.1. Werbeziele.- 4.4.2. Entwurf zweier Kampagnen.- 4.4.3. Werbepretests.- 4.4.3.1. Grundsätzliches zu Werbepretests.- 4.4.3.2. Durchföhrung des Werbepretests.- 4.4.4. Ergebnis: Die Einföhrungskampagne.- 4.5. Zusammenfassung.- 5. Testmarktforschung.- 5.1. Ziel der Testmarktforschung.- 5.2. Informationsbedarf und Informationsbeschaffung.- 5.2.1. Grundsätzliche Möglichkeiten.- 5.2.2. Vorgehen.- 5.3. Testen der Verbraucherreaktionen im Minimarkttest.- 5.3.1. Grundsätzliches zum Minimarkttest.- 5.3.2. Ziel der Verbraucherreaktionsmessung.- 5.3.3. GfK Behavior Scan versus Nielsen Telerim.- 5.3.4. Durchföhrung des Minimarkttests.- 5.3.5. Ergebnis: Akzeptanz beim Verbraucher.- 5.4. Test der Absatzmittlerreaktionen im regionalen Markttest.- 5.4.1. Ziel des Markttests.- 5.4.2. Durchföhrung eines regionalen Markttests.- 5.4.3. Ergebnis: Akzeptanz im Handel.- 5.5. Zusammenfassung.- 6. Produkteinföhrung.- 6.1. Gesteckte Ziele.- 6.2. Informationsbedarf und Informationsbeschaffung.- 6.3. Ergebnis: Erfolg im Markt.- 6.3.1. Ergebnisse der Panel-Standardauswertung.- 6.3.2. Ergebnisse der Panel-Sonderanalysen.- 6.3.2.1. Entwicklung der Erst- und Wiederkäuferrate.- 6.3.2.2. Einkaufsintensität.- 6.3.2.3. Käuferstrukturanalyse.- 6.3.2.4. Bedarfsdeckung, Markentreue, Nebeneinanderverwendung.- 6.3.2.5. Käuferwanderung.- 6.3.2.6. Gain-and-Loss-Analyse.- 6.3.2.7. Sonstige Ergebnisse.- 6.3.3. Ergebnisse der Verbraucherbefragung.- 6.4. Fazit.- 7. Schlußbemerkungen.- Literaturempfehlungen.- Sachwortverzeichnis.